was noch vor über 70 Jahren geschah
- Ausstellung Kriegsende vor 60 Jahren
- Stabbrandbombe wurde zum Verhängnis
- Bucheckernsuche wird zum Kampf um Leben und Tod

Ausstellung Kriegsende vor 60 Jahren
Über die Zustände in manchen amerikanischen wie auch französischen Kriegsgefangenenlagern hat Eugen Nies anlässlich unserer Ausstellung „Kriegsende vor 60 Jahren“ sowohl in Worten als auch durch Bilder kurz berichtet. Was er aber, nachdem er dem damaligen Inferno lebend entkommen konnte, anschließend noch erlebte, hat er später in seinen Erinnerungen wie folgt festgehalten:
„D i e H e i m k e h r
Am Freitag, 27.Juli 1945, konnten wir endlich, unbeschreiblich glücklich, das riesige Gefangenenlager mit seinen über 20 Einzelcamps und sicher um die 200.000 Gefangenen verlassen. Mensch, man soll es kaum glauben: Wir konnten auf einmal sogar wieder aufrecht gehen. wenn auch nur sehr mühsam. Aber nicht sehr weit. Denn im nächsten Dorf, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, erhielten wir als erstes Lebensmittelkarten. Diese waren viel wichtiger als Geld, was wir ja ohnehin nicht mehr hatten. Im nächsten Laden bekamen wir von guten Menschen - auch ohne Geld - Brot und etwas Käse. Auf der Staffel vor dem Laden sitzend aßen wir uns zuerst einmal so richtig satt, um dann von einer Frau mit nach Hause genommen zu werden, wo es auch noch Bohnensalat und genug Kartoffeln für uns gab. Anschließend, es war schon fast Abend geworden, richtete sie für uns - wir waren zu zweit - noch provisorische Schlafstellen ein, was wir gerne annahmen. O war das ein himmlisches Gefühl, endlich mal wieder wie in einem Bett zu schlafen.
Am nächsten Morgen brachte uns ein offener Güterzug nach Bingen. Irgendwann ging es von dort per Bahn weiter nach Weinheim. Über Nacht gelangten wir dann, wie weiß ich gar nicht mehr, nach Heidelberg. Dort sagte man uns, dass erst gegen Abend der nächste Zug Richtung Karlsruhe fahren werde. Sonntag Morgen! Solange wollte ich einfach nicht warten, also trottete ich, zu tragen hatte ich ja nichts, los Richtung Autobahn. In deren Nähe befand sich ein großer Bauernhof, wo es für uns, wir waren wieder zu zweit, sogar ein Mittagessen gab. Danach ab auf die Autobahn, einfach auf gut Glück weiter Richtung Süden. Und man soll es kaum glauben: Nach nicht allzu langer Zeit kam tatsächlich ein Traktor und nahm uns ein Stück, wie er meinte, mit. Der gute Mensch wollte nach Durlach fahren! Wir hätten am liebsten ein Halleluja gejubelt. So also kamen wir bis nach Durlach. Und dort mit der Straßenbahn, welche schon wieder fuhr, zum Karlsruher Hauptbahnhof. Da sah ich einen mir bekannten Eisenbahner, er hieß Zimmer, mit seinem Fahrrad. Und den bat ich inständig, er möge doch, wenn er in Malsch sei, meinen Eltern sagen, dass ich bald komme und arg Hunger habe. Wir aber gelangten, vermutlich mit der Albtalbahn (?), nach Ettlingen. Von dort aus, es waren ja nur noch zehn Kilometer, liefen wir so rasch wir konnten, weiter Richtung Malsch.
Zwischen Ettlingen und Bruchhausen kommen mir dann drei Radfahrer entgegen: Vater, Mutter und Schwester Liesel. Ich bleibe wie angewurzelt stehen - und alle drei fahren an mir vorbei! Erkannten mich also nicht wieder. Doch dann, kaum 20 Meter weiter: Mutter dreht sich plötzlich um und schreit: „O mei Bu !“. Noch heute für mich immer wieder zum Heulen. Wie wir dann nach Malsch kommen, läuten gerade die Glocken der Pfarrkirche zur sonntäglichen Abendandacht

Welch unbeschreiblicher, herrlicher Empfang!
Bei der Gemeinde meldete ich mich aber erst am Dienstag, 31. Juli 1945 zurück. Ich brauchte einfach etwas Zeit, um zu begreifen, dass ich wieder daheim sei.
Die nächsten Tage und Wochen waren dann trotz aller Freude schon recht hart. Ich konnte zum Beispiel in meinem (weichen) Bett einfach nicht schlafen, musste bei Nacht zwischendurch immer wieder etwas essen, bekam bald die Krätze und geschwollene Augen wegen Nierenproblemen.
Trotzdem aber ging es von Tag zu Tag, wenn auch langsam, wieder aufwärts, mit einem Wort: DAHEIM. Deo gratias.“
Da sich dieser „Heimkehrtag“ morgen, also am Freitag, 29. Juli 2005, zum 6o. Mal jährt, ist es doch wert, sich rückblickend wieder an solche und noch viele andere schlimme Nachkriegsschicksale zu erinnern.
Die beiden Bilder stammen aus dem Buch ‚Der geplante Tod‘ von James Bacque.
Eine Stabbrandbombe wurde zum Verhängnis

Zwei Malscher Buben, die in der Nachkriegszeit mit Munition spielten und
wurdenbdabei so schwer verletzt , dass einer der beiden anschließend verstarb. Rainer Walter dokumentierte die damaligen Ereignisse nach Berichten von Zeitzeugen. Der Zweite Weltkrieg war schon
fast 10 Jahre zu Ende. Auf der gesamten Gemarkung der Gemeinde Malsch wurden immer wieder Munition und Waffen gefunden.
So kam es zu folgendem Vorfall in den Osterferien des Jahres 1954. In der Nähe der heutigen Goethestraße fanden Wilfried Lang und sein Schulfreund Hans Bogesch eine Stabbrandbombe. Sie wollten diese öffnen, um die Aluminiumhülle an einen Malscher Schrotthändler zu verkaufen. Wie man das machte, hatten sie schon öfter bei anderen Jugendlichen beobachtet. Nachdem sie damit aber keinen Erfolg hatten, machten sie in einem nahen Bombentrichter ein Feuer und warfen die Stabbrandbombe in die Flammen. Kurz darauf erfolgte eine starke Explosion, die man bis nach Malsch hinein hören konnte.
Beide Buben wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzungen Wilfrieds waren so erheblich, dass er nach zwei Tagen am 23. April 1954 verstarb. Hans Bogesch überlebte, hat aber noch heute eine Vielzahl von Splittern im Körper, von denen immer wieder welche abgestoßen werden. Er erzählte Rainer Walter, dass er die Explosion so erlebte, als hätte ihm jemand eine Rübe auf den Kopf geschlagen.
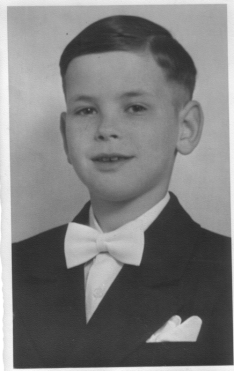
Christa Bach, die Schwester Wilfried Langs erinnerte sich an den Unfalltag 1954:
Es war Mittwoch. Christa hatte nachmittags frei und kam mit dem Zug am Malscher Bahnhof an. Dort wurde sie fast immer von ihrem Bruder abgeholt. Nicht jedoch an jenem Tag.
Als sie zu Hause ankam, fragte ihre Mutter, Frau Elfriede Lang, wo denn Wilfried sei. Noch während sie miteinander sprachen, hörten sie ganz in der Nähe einen lauten Knall. Wie von einer Ahnung getrieben rief die Mutter den Namen ihres Sohnes Wilfried und rannte aus dem Haus auf die Goethestraße. Nach wenigen Schritten kam ihr ein Gipser entgegen, der auf den dortigen Neubauten gearbeitet hatte. In seinen Armen trug er das schwer verletzte Kind.
Ein Nachbar, der damals schon ein Auto besaß, fuhr den Verletzten und dessen Schwester sofort ins Diakonissenkrankenhaus nach Karlsruhe. Bei der Untersuchung stellte man hauptsächlich Splitterverletzungen im Bauchbereich mit starkem Blutverlust fest. Sofortige Bluttransfusionen waren erforderlich. Da Wilfried und Christa die gleiche Blutgruppe hatten, bekam er Blut von seiner Schwester zugeführt. Trotz aller Bemühungen der Ärzte starb Wilfried nach zwei Tagen. Er wurde nur zehn Jahre alt. Bei seiner Beerdigung waren alle seine Klassenkameraden und seine Lehrer anwesend.
In Malsch werden heute noch viele Geschichten über Katastrophen wie die oben berichtete weitererzählt. Kinder und Jugendliche waren in der Nachkriegszeit auf Grund ihrer Neugier und Abenteuerlust noch lange Gefahren ausgesetzt, von denen wir uns heute kaum noch eine Vorstellung machen können.
Folgende Geschichte berichtet über einen Vorfall, der damals gerade noch glimpflich endete: Einige Malscher Jugendliche fanden eine Fliegerbombe. Sie holten einen Schubkarren, luden sie auf und fuhren damit zum Schrotthändler Kuhn, um ein bisschen Geld dafür zu bekommen. Entsetzt hat Herr Kuhn sofort die Polizei gerufen. Ein Munitionsräumkommando musste die Bombe dann entschärfen.
Bucheckernsuche wird zum Kampf um Leben und Tod

Hier geht es um drei Malscher Buben, die beim Suchen von Bucheckern zur Gewinnung von Öl im Malscher Hardtwald die Explosion einer Mine auslösten und verletzt wurden.
Rainer Walter recherchierte und dokumentierte über die damaligen Ereignisse mit dem letzten noch lebenden Beteiligten Manfred Kienzle, sowie weiteren Personen aus dem Kreise der Familienangehörigen Kunz und Neukert.
Am 14. Oktober 1946, siebzehn Monate nach Ende des 2. Weltkrieges, trafen sich die drei Buben Manfred Kienzle, geboren 1935, Herbert Kunz (genannt "Sam"), geboren 1934 und Kurt Neukert (genannt "Mond") geboren 1936 zum Sammeln von Bucheckern. In diesem Jahr gab es in den Malscher Wäldern große Mengen dieser Buchensamenkerne. Die wurden in der Notzeit nach dem Krieg zur Gewinnung von Speiseöl verwendet.
Die Buben gingen über den Lindenhardter Weg bei der Papierfabrik Richtung Hardtwald, überquerten die heutige Bundesstraße 3. Im Wald angekommen fanden sie ein eingezäuntes Gebiet mit einer Tafel "gesperrt - Minengefahr". Aber genau in diesem Bereich waren große Mengen von Bucheckern zu finden - dort suchte ja kaum jemand wegen der Gefahr. Herbert war bekannt, dass in diesem Sperrgebiet noch Minen lagen, die mit Stolperdrähten verbunden waren. Trotzdem liefen die drei Jungs im Gänsemarsch - Herbert voraus gefolgt von Kurt und Manfred - auf einem Trampelpfad ins Minenfeld.
An dessen Ende blieb Herbert an einem unter dem Laub gespannten Stolperdraht hängen und löste die Explosion einer Mine aus. Nach der Detonation lag Herbert jammernd mit zerfetztem linken Bein am Boden. Kurt lag ohnmächtig daneben mit einem großen Splitter im Kopf, Manfred hatte eine kleine Splitterverletzung am Hals. Edwin Koffler aus Malsch, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Nähe befand, fuhr umgehend mit dem Fahrrad nach Neumalsch zu einem
amerikanischen Grenzposten, den er von dem schrecklichen Ereignis verständigte. In Neumalsch war damals die Grenze zwischen amerikanischer und französischer Besatzung. Der Posten, ein afroamerikanischer Soldat, fuhr sofort mit dem Jeep zum Unfallgelände und holte die Verletzen aus dem Sperrgebiet. Das zerschmetterte Bein von Herbert wurde mit einem Gürtel fixiert.
Mit den eingeladenen Verletzten fuhr der Jeep mit lautem Hupen und einem Soldaten auf dem rechten Kotflügel mit hoher Geschwindigkeit ins Rüppurrer Krankenhaus. Der auf dem Kotflügel sitzende Soldat machte mit heftigem Winken die Straße frei. Im Krankenhaus sagte man, dass es zum jetzigen Zeitpunkt aus Ärztemangel nicht möglich wäre, Herbert zu operieren. Der Amerikaner bestand jedoch auf sofortige Hilfe. Dies hat Herberts Leben gerettet. Lebenslang redete er von seinem Lebensretter "Blacky".
Im Krankenhaus versuchten die Ärzte das Bein zu retten. Leider heilte die Wunde nicht, sodass das Bein unter dem Knie amputiert werden musste. Er verlor sehr viel Blut und benötigte eine Bluttransfusion. Seine Tante Rosa Neukert geborene Kunz - Mutter von Kurt - hatte die gleiche Blutgruppe und spendete ihm Blut. Auch die Amputationswunde hat sich nach einigen Tagen nicht geschlossen, so dass eine erneute Amputation über dem Knie erforderlich wurde.
Herbert musste nach seinem langen Krankenhausaufenthalt mit einer Holzprothese (Piraten-Holzfuß) gehen. Er wurde daher "Stelze" genannt. Nach einigen Jahren bekam Herbert eine professionelle Prothese. Später entstand wegen des Holzbeines der Spitzname "Sam".
Trotz seiner Behinderung betätigte sich Herbert auch sportlich. Er war in den 1950er Jahren in der Boxsportgruppe im Gasthaus Adler und trainierte mit den damaligen Malscher Boxsportgrößen wie z.B. Toni Krämer, Franz Ihli und Ewald Axtmann und weiteren Boxern. Ein großes Hobby war auch das Schwimmen. Immer wieder konnte man ihn im Malscher Schwimmbad mit abgelegter Prothese antreffen.
Kurt lag einige Wochen ohne Bewusstsein im Krankenhaus. Der Splitter konnte nicht entfernt werden. Er blieb ihm verkapselt im Kopf erhalten. Er litt lebenslang unter Kopfschmerzen und war sehr wetterfühlig. Durch die Gehirnverletzung war er immer gewissen Gemütsschwankungen unterworfen.
Mit dieser Behinderung betätigte er sich viele Jahre im TV Malsch als Handballspieler. Ein weiteres Hobby war das Skat spielen. Bei Manfred wurde am Hals ein 5 mal 5 Millimeter großen Splitter, der ihn stets beim Schlucken beeinträchtigte, entfernt. Am nächsten Tag wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Manfred nahm den entfernten Granatsplitter mit nach Hause. Leider ging das Objekt im Laufe der Jahre verloren.
